Von Daniel Dockerill
Der folgende Text ist das überarbeitete Extrakt einer Auseinandersetzung, die sich im Frühjahr 1997 im Hamburger „Offenen Kommunistischen Forum“ (OKF) zutrug und sich um Fragen der Marxschen Untersuchung der Ware im Eingang seines Hauptwerkes Das Kapital sowie um deren Rezeption drehte.
Spezieller ging es um jenen Teil, welcher dem Tauschwert, d. h. der sehr eigenartigen Form gewidmet ist, die der ökonomische Wert der Ware im Unterschied zu ihrem jedermann handgreiflichen Gebrauchswert annimmt und die uns in ihrer entwickeltsten Gestalt schließlich als Geld entgegentritt.
In Abgrenzung zwar gegen eine unter dem Etikett der „Wertkritik“ firmierende Rezeption der Marxschen Warenanalyse bemüht sich der Text um die dadurch nötig werdende Richtigstellung insbesondere der in diesem Kontext entscheidend wichtigen Untersuchung der Wertform.
Jedoch enthielt der Originaltext Passagen von mittlerweile nur noch geringem Interesse, weil sie einige – seinerzeit vom Vertreter einer der Zeitschrift GegenStandpunkt nahestehenden Hamburger Gruppe namens „Kritik und Diskussion“ vorgetragene – jenem Genre der „Wertkritik“ zwar durchaus zuzuordnende, aber in sehr extravaganter Weise fehlerhafte Aussagen detaillierter wiedergaben und einer polemischen Kritik unterzogen. Diese wurden hier größtenteils weggelassen oder gekürzt.
DD, Mai 2004
Kleines Vorspiel
Der Marx-belesene Wertkritiker spricht:
„Die qualitative Gleichsetzung allen Reichtums als Wert ist die erste Bestimmung kapitalistischer Gesellschaften. Sie enthält den entscheidenden Widerspruch dieser Gesellschaftsform: Ihr produzierter Reichtum besteht (genauso wie der aller anderen Gesellschaftsformen) aus einer Vielzahl unterschiedlichster Gebrauchswerte, die jedoch im Kapitalismus gesellschaftlich – (individuell schon!) – nicht als solche gelten.“[1]
Der altbackene Traditionsmarxist widerspricht:
„Dass Reichtum die Anhäufung einer bestimmten Quantität von Werten ist, kann nicht die erste Bestimmung kapitalistischer Gesellschaften sein, denn Reichtum (was eine bestimmte, quantitative Anhäufung von Werten ist), existierte auch in den Gesellschaften der Sklavenhalter und im Feudalismus.“[2]
Vom Tauschwert
„Die Wertform oder der Tauschwert“ ist der dritte Unterabschnitt des Kapitels über „Die Ware“ überschrieben; mit dem der erste Band des Marxschen Hauptwerkes „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie“ beginnt. Bei diesem Unterabschnitt handelt es sich um den nach allgemeiner Ansicht schwierigsten und zugleich in vieler Hinsicht für das Verständnis der Kritik der politischen Ökonomie insgesamt entscheidenden Teil der Marxschen Formanalyse der Ware.
Diese Untersuchung der Wertform untergliedert sich weiter in
1. Die beiden Pole des Wertausdrucks: Relative Wertform und Äquivalentform
2. Die relative Wertform
a. Gehalt der relativen Wertform
b. Quantitative Bestimmtheit der relativen Wertform
3. Die Äquivalentform
4. Das Ganze der einfachen Wertform
B. Totale oder entfaltete Wertform
1. Die entfaltete relative Wertform
2. Die besondere Äquivalentform
3. Mängel der totalen oder entfalteten Wertform
C. Allgemeine Wertform
1. Veränderter Charakter der Wertform
2. Entwicklungsverhältnis von relativer Wertform und Äquivalentform
3. Übergang aus der allgemeinen Wertform zur Geldform
D. Die Geldform
Wer im Kontext der Kritik der politischen Ökonomie heutzutage sich mit Fragen der Formanalyse der Ware und ihren Folgerungen beschäftigt, hat es neben der von jedem Problembewusstsein unbeschwerten Affirmation der aus der Ware entspringenden Fetische immer auch mit einer zweiten, scheinbar reflektiert kritischen Variante derselben Affirmation zu tun. Während erstere in der Tat zwischen Wert und Gebrauchswert keinen Unterschied festhalten und „Reichtum“ in allen möglichen Gesellschaften unversehens als „quantitative Anhäufung von Werten“ bezeichnen kann, streicht letztere bei jeder Gelegenheit den Wert als Problem heraus, der den Menschen im Kapitalismus den Gebrauchswert, die konkrete, sinnliche Nützlichkeit ihrer Mühen permanent zu Schanden reite. Dass sich die gesellschaftlichen Dinge in Wahrheit doch etwas verzwickter verhalten, erkennt sofort jeder, der nicht vor Verliebtheit in seine ach so kritischen Abstraktionen blind durch die Welt läuft. Und so kommt es, dass die wertunkritische (gerne „traditionsmarxistisch“ geschimpfte) Affirmation mitten ins Schwarze trifft, wenn sie beispielsweise der Wertkritik (gegen deren Aussage, dass die „Gebrauchswerte ... jedoch im Kapitalismus gesellschaftlich ... nicht als solche gelten“) demonstriert, wie schon in bestimmten Formen des Lohns das Diktat just des Gebrauchswerts über den Arbeiter sich gründlicher verwirklicht, als es frühere Produktionsverhältnisse jemals gestatteten.[3]
Bezüglich der die Waren produzierenden Privatarbeiten spricht Marx von ihrem „doppelten gesellschaftlichen Charakter“. Sie müssen zuallererst mit ihrem Produkt „ein bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen“. Täten sie es nämlich nicht, erwiesen sie sich daher nicht als bestimmte Glieder der naturwüchsig geteilten gesellschaftlichen Arbeit, dann gäbe es gar keinen Zwang zum Austausch der Arbeitsprodukte, der erst die Produzenten dem Gesetz des Austauschs, dem Wertgesetz unterwirft. Andererseits erhalten sie den Ausweis ihrer Zugehörigkeit zum „naturwüchsigen System der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit“ nicht mehr unmittelbar in der konkreten Gestalt ihrer besonderen Nützlichkeit, sondern erst auf dem Umweg ihrer „Reduktion auf den gemeinsamen Charakter, den sie als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft schlechthin, auf abstrakt menschliche Arbeit, besitzen.“[4] Es liegt aber die Problematik des Werts keineswegs darin, dass dieser abstrahiert von der, jeweils für sich genommen immer auch bornierten, besonderen Nützlichkeit der verschiedenen Teilarbeiten, sondern in der Form, die diese Abstraktion im Wertcharakter der Arbeitsprodukte annimmt; darin, dass sie sich hinter dem Rücken der Produzenten, in der Art einer von diesen unabhängigen Naturgewalt vollzieht.
Wenn der Traditionsmarxist insistiert, dass die behauptete „erste Bestimmung kapitalistischer Gesellschaften“ durch die „qualitative Gleichsetzung allen Reichtums als Wert“ auf dem Mist unseres Wertkritikers gewachsen sei und nichts mit der Marxschen Darstellung zu tun habe, dann hat er völlig recht – wie eigenartig hölzern, pedantisch und windschief auch immer er seinen Vorwurf begründet. „Die qualitative Gleichsetzung allen Reichtums als Wert“ ist nämlich weder eine „erste“, noch eine zweite oder sonst weitere, sondern überhaupt keine „Bestimmung kapitalistischer Gesellschaften“. Sie ist allenfalls die Beschreibung eines ersten, gleichwohl manchmal bleibenden Eindrucks, den die Lektüre des ersten Kapitels des Marxschen Kapitals heutzutage bei wertkritisch indoktrinierten Linken offenbar notorisch hinterlässt. Ihrem Gehalt nach wäre sie – folgt man dem Marxschen Gang der Untersuchung und deren Terminologie – zunächst weiter nichts als eine umständliche Tautologie, ungefähr so erhellend wie die Gleichsetzung aller schwarzen Pferde als Rappen.[5]
Marx notiert als erste Eigenart von „Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht“, dass ihr Reichtum „als eine ungeheure Warenansammlung“ erscheine, und bezeichnet die Ware als dessen „Elementarform“, mit deren Untersuchung seine Darstellung des kapitalistischen Kosmos’ daher beginnt. Die Ware wiederum erscheint sofort als zwieschlächtiges Ding; Gegenstand einerseits der Aneignung, andererseits der Entäußerung, und zwar jeweils eines das andere sowohl ausschließend als auch bedingend. Sie ist einerseits ein Gegenstand, der wegen seiner Fähigkeit, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen, und indem er es befriedigt, angeeignet wird. Andererseits aber muss ihr Besitzer, wegen der Unfähigkeit desselben Gegenstandes, seine bestimmten Bedürfnisse zu befriedigen (außer dem einen, im Austausch gegen ihn einen anderen, ihm tatsächlich nützlichen zu erhalten) sich ihrer entäußern. Die Ware erscheint also als Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert. Sie ist beides, die Einheit beider Bestimmungen, und ist doch nur Gebrauchswert, sofern sie nicht Tauschwert bzw. Tauschwert nur, sofern sie nicht Gebrauchswert ist. Die Bestimmung als Gebrauchswert teilt der Reichtum als kapitalistischer mit allen seinen früheren gesellschaftlichen Formen. Was den Kapitalismus von allen früheren Gesellschaftsformationen unterscheidet und so zu einer bestimmten eigenen macht, sind der allgemein gewordene Austausch der produzierten Gebrauchswerte, der regelmäßig vor ihrem Gebrauch statthaben muss, und die mit dieser Allgemeinheit des vorgeschalteten Austauschs einhergehenden spezifischen Formen des zwischenmenschlichen Verkehrs. Der elementarste, einfachste Ausdruck der Allgemeinheit des Austauschs der Arbeitsprodukte ist aber ihr Tauschwert.
Im Tauschwert endlich erscheinen verschiedene Gebrauchswerte als in je bestimmten Proportionen einander gleichgesetzt, und insofern ihre qualitative Verschiedenheit, die sie erst als zum Austausch prädestinierte Gebrauchswerte auszeichnet, also überhaupt ihre Bestimmung als Gebrauchswerte ausgelöscht. Dieses Gleiche, das der Tauschwert der Waren ausdrückt, ohne zu verraten, was es denn positiv ist, nennt Marx „Wert“.[6] Mit seiner Bezeichnung als „Wert“ ist es jedoch zunächst nur benannt und keineswegs schon bestimmt, oder richtiger: Bestimmt ist nur erst, was es nicht ist; es ist dahin bestimmt, nicht Gebrauchswert zu sein, obwohl es nur in Gebrauchswerten erscheint. Die Marxsche Analyse der Ware sucht demnach zunächst zu klären, was es mit dem Wert als dem der Gleichsetzung der Gebrauchswerte Zugrundeliegenden näher auf sich hat. Mit anderen Worten: Marx geht es zunächst um die Bestimmung des Werts selbst, dessen, was er seinem Gehalt nach ist, und zwar an jenem Gegenstand, an dem er ihn gefunden hat: an der Ware,[7] statt etwa darum, mit dem Etikett des Werts („als Wert“) „den Kapitalismus“ zu „bestimmen“. Als diesen Gehalt macht Marx, hierin im Einklang mit den Klassikern der politischen Ökonomie, um deren Kritik es bei Marx sich handelt, die Arbeit aus. Als Gehalt, als Bestimmungsgrund des alles gleichmachenden Werts aber spezifiziert Marx diese Arbeit sodann näher als abstrakte Arbeit.
Kleines Repetitorium über abstrakte Arbeit
Die Arbeit nämlich, soweit sie die Wertsubstanz, also jene gleiche, allen Waren gemeinsame Qualität bildet, die deren Austausch als regelndes Maß dient, ist rein gesellschaftlich bestimmt, d.h. die Beschaffenheit des Produkts, in dem die Arbeit sich verwirklicht, spielt für ihre wertbildende Seite keine Rolle, sondern nur die Tatsache, dass überhaupt gearbeitet wurde: dass Menschen die in ihrer spezifisch menschlichen Physiologie begründete Fähigkeit zu zweckmäßiger Tätigkeit haben wirken lassen. Indem alle konkret verschiedenen, weil unterschiedlichen Zwecken unterworfenen Arbeiten so reduziert werden auf unterschiedslos menschliche Arbeit, zweckmäßiges menschliches Tun, werden sie reduziert auf etwas, das ihnen allen gemeinsam ist, worin sie sich alle gleichen. In dieser Gleichheit aller Arbeiten ist von jeglicher Beziehung derselben auf ihre jeweils besonderen Gegenstände (einschließlich ihrer gegenständlichen Resultate: Produkte) vollkommen abgesehen (abstrahiert). Stattdessen sind darin die arbeitenden Individuen aufeinander bezogen, nämlich als arbeitende: als je individuelle Repräsentanten der allen gemeinsamen Fähigkeit, für sich und füreinander – in welcher besonderen Form auch immer – irgend zweckmäßig sich zu betätigen: zu arbeiten. Die Bestimmung der Arbeit als gleiche menschliche Arbeit wird also allein aus der gesellschaftlichen Beziehung der Produzenten untereinander gewonnen.
Aber wohlgemerkt: Diese Reduktion der Arbeiten auf gleiche menschliche Arbeit gilt in Bezug auf ihren wertbildenden Aspekt, keineswegs ist damit überhaupt die in der Produktion der Ware verausgabte Arbeit darauf reduziert. Die Ware ist (s. o.) die (gegensätzliche) Einheit von Wert und Gebrauchswert, daher die warenproduzierende Arbeit die (gegensätzliche) Einheit von konkret nützlicher und abstrakt menschlicher Arbeit. Es ist also das Problem warenproduzierender Arbeit, dass sie nicht unmittelbar als gesellschaftliche Arbeit gilt, dass vielmehr das Moment abstrakt menschlicher Arbeit an ihr in Gegensatz tritt zum Aspekt ihrer konkreten Nützlichkeit. Der Warenproduzent mag konkret in der Produktion seiner Ware unter Umständen so sorgfältig und fleißig gearbeitet haben, wie er will, ohne dass seine Arbeit gesellschaftlich überhaupt etwas gilt, d.h. deren Produkt ihm auch abgenommen wird.
Hält man jedoch wertkritisch die abstrakte Arbeit an sich für die zu beseitigende Verrücktheit des Kapitalismus, dann entgeht daher die wirkliche Besonderheit warenproduzierender Verhältnisse: der Gegensatz, in den darin gegen die je konkrete Gestalt der Arbeit der an sich immer in ihr enthaltene Aspekt gerät, dass sie die individuelle Äußerung eines allgemeinen, spezifisch menschlichen Vermögens ist. Es ist diese seine gegensätzliche Form, in der besagtes Vermögen überhaupt erstmals zu seinem Recht kommt, erstmals als allgemeines einen bestimmten Ausdruck erhält und nicht mehr nur als die unter ihren besonderen Ausdrucksweisen, den besonderen menschlichen Schöpfungen verborgene, darin festgehaltene, stumme, ungewusste, höchstens dumpf geahnte Triebkraft der Geschichte wirkt.[8] Aber indem es sich als die Allgemeinheit aller seiner besonderen Ausdrucksweisen, als allgemeines, allen konkreten Produktionen zugrundeliegendes menschliches Vermögen gegen dieselben geltend macht, indem es aus ihnen herausgehoben erscheint, erscheint es zugleich selbst noch als Besonderes; nur eben nicht mehr als besonderes Vermögen besonderer Individuen, Gruppen, Kasten, Klassen, sondern als unabhängig von jeder solchen menschlichen Besonderheit als – Sache, als sachliche Eigenschaft der menschlichen Produkte, die deren Schöpfer beherrscht.
Von der Substanz zur Form des Wert
Die Reduktion der Waren auf abstrakte Arbeit, die Marx als das Geheimnis ihrer Gleichsetzung als Wertdinge enthüllt, löst zunächst deren Gegenständlichkeit auf oder verwandelt diese, wie Marx es ausdrückt, in eine „gespenstige Gegenständlichkeit“: entdinglicht gewissermaßen, soweit als werttragend betrachtet, die einzelne Ware. Der Wert seinem Inhalt nach hat sich als eine vollkommen ungegenständliche Angelegenheit herausgestellt, der die Waren lediglich gesellschaftlich, als Produkte gesellschaftlicher Individuen bestimmt. Und doch wurde diese ungegenständliche Bestimmung nur gefunden an einem Gegenstand, eben der Ware. Sie muss also selber gegenständlichen Ausdruck haben. Von diesem, von der Form des Werts, nahm die Analyse ihren Ausgang, aber zunächst nur so, dass die Form – die Vergleichung, daher qualitative Gleichsetzung gänzlich verschiedener Gebrauchswerte – auf einen unter ihr verborgenen, also von ihr als Form verschiedenen Inhalt verwies. Zu dessen Bestimmung musste darum von der Form abstrahiert werden. Der Inhalt aber weist nun seinerseits zurück auf jene Form:[9]
Die Ware ist Gebrauchswert und Wertding in einem, jedoch so, dass sich beide Bestimmungen gegenseitig ausschließen. Was die Ware als Wertding ist, ergab sich gerade daraus, dass von ihrem bestimmten Charakter als nützlicher Gegenstand abstrahiert wurde, und andersherum zeigt sich die einzelne Ware in ihrer konkreten Gestalt immer nur als ordinärer Gebrauchswert und bleibt gerade darum „unfassbar als Wertding“[10], wie Marx schreibt. Jedoch sagt die gefundene Bestimmung des Warenwerts selbst, wo dieser fassbar ist.
Wie nämlich für die abstrakte Arbeit die arbeitenden Individuen nur als individuelle Inkarnationen einer einzigen gesellschaftlichen Arbeitskraft in Betracht kommen, so deren Produkte nur als reine Gesellschaftsdinge, Vergegenständlichungen ein und derselben gesellschaftlichen Arbeit. Als Wertdinge treten die Waren folglich nur dort in Erscheinung, wo sie ihren gesellschaftlichen Charakter betätigen, d.h. zueinander in Beziehung treten. Die Analyse dieser Beziehungen der Waren aufeinander hat zu zeigen, wie darin der Wertcharakter der Arbeitsprodukte zur gegenständlichen Darstellung kommt, und erst diese Analyse erlaubt ein (erstes, noch keineswegs abschließendes) Urteil über die Kategorie des Werts und jene darin ihren ersten, ins Auge springenden Dollpunkt besitzende spezifische, historisch bestimmte gesellschaftliche Formation, die in besagter „ungeheuren Warensammlung“ in Erscheinung tritt.
Die Analyse der Wertform
Der fertige Wertausdruck der Waren, der entwickelte Tauschwert bzw. die ausentwickelte Wertform ist die Geldform. Mit der Wertformanalyse verfolgt Marx die Absicht, „die Genesis dieser Geldform nachzuweisen, also die Entwicklung des im Wertverhältnis der Waren enthaltenen Wertausdrucks von seiner einfachsten unscheinbarsten Gestalt bis zur blendenden Geldform zu verfolgen“ und damit „das Geldrätsel“ zu lösen.[11] Die (bürgerliche) politische Ökonomie hatte bereits lange vor Marx entdeckt, dass das Geld seinem Wesen nach selbst nur eine Ware, daher das Verhältnis Ware–Geld im Grunde einfaches Wertverhältnis einer Ware zu einer beliebigen anderen ist, beließ es aber bei der bloßen Entdeckung, sah sich also dieses einfache Verhältnis nicht näher an – geschweige denn dessen Unterschied zu, sowie Zusammenhang mit der entwickelten Geldgestalt – und verfiel daher immer wieder darauf, dem Geld Wundertaten anzudichten wie etwa diejenige, dass es, nämlich das Geld, allererst den Waren ihren Wert verleihe und ihre Zirkulation in Gang setze.[12]
Marx beginnt also seine Analyse mit der einfachen Wertform „x Ware A ist y Ware B wert“, um darin, wie er schreibt, dem „Geheimnis aller Wertform“ auf die Spur zu kommen. Dabei hält Marx als erstes fest, dass die Ware, die ihren Wert ausdrückt, „eine aktive“, die Ware, die „zum Material dieses Wertausdrucks“ diene, dagegen „eine passive Rolle“ spiele. Die als Wert an der einzelnen Ware unsichtbar kristallisierte abstrakte Arbeit findet als Material ihres Ausdrucks nur ihr Gegenteil vor, nämlich ordinäre Warenkörper, Gebrauchswerte, konkrete Produkte konkreter Arbeit.
Relative Wertform und Äquivalentform
Die konkrete Arbeit stellt sich hinreichend dar in ihrem eigenen Produkt, der Gebrauchswertgestalt der Ware. An einer Darstellungsform mangelt es bislang dagegen der abstrakten Arbeit bzw. deren bloß „gespenstiger“ Vergegenständlichung an der einzelnen Ware, dem Wert. Und vom Ausdruck eben dieses Werts, von der Wertform handelt die Analyse. Demnach ist klar, dass nicht die konkrete, sondern die abstrakte Arbeit der ersten Ware sich in der zweiten darstellt; und dies durchaus angemessen, insofern sie sich damit als von der den Gebrauchswert der ersten Ware herstellenden Arbeit verschiedene, also dieser gegenüber andersgeartete Arbeit darstellt.
Dies ist dann auch der qualitative Unterschied der relativen Wertform, in der sich die erste, ihren Wert ausdrückende Ware befindet, gegenüber der Äquivalentform, die sie jener zweiten Ware, worin sie ihren Wert ausdrückt, aufprägt. Erscheint nämlich in der relativen Wertform einer Ware ihr Wert im Gebrauchswert einer anderen Ware und ist daher von ihrem eigenen Gebrauchswert sinnfällig unterschieden, so erscheint auf der Seite der Äquivalentform im Gebrauchswert einer Ware dessen eigenes Gegenteil; sie repräsentiert in ihrer eigenen ordinären Gebrauchswertgestalt unmittelbar den beiden Waren als ihre gemeinsame Bestimmung zukommenden Wert. Wert und Gebrauchswert dieser Ware fallen ununterschieden zusammen, d.h. sie besitzt keinen eigenen von ihrem Gebrauchswert zu unterscheidenden Wertausdruck.
Halten wir zunächst fest: Sowohl in der relativen Wertform als auch in der Äquivalentform erscheint der Wert bzw. die abstrakte Arbeit in der Gestalt eines Gebrauchswerts bzw. einer konkreten Arbeit. Der Wertausdruck von Seiten der ersten Ware, als Ausdruck ihres Werts betrachtet, gibt an sich selber, in der Form selbst, die der Warenwert hier erhält, zu erkennen, dass der Wert, den er ausdrückt, nicht dieser Ware als ihre natürliche Eigenschaft entspringt, sondern ihrem gesellschaftlichen Verhältnis[13] zu anderer Ware. Von der Seite der zweiten, zum Äquivalent dienenden Ware aus betrachtet stellt sich die Sache anders dar. Die zweite Ware dient zwar nur dazu den Wert der ersten Ware zu verkörpern, nicht ihren eigenen, aber das kann sie nur, weil sie selbst an sich Wertding ist, weil zu ihrer Produktion wirklich menschliche Arbeit aufgebracht wurde. Dieses ihr Wertsein tritt nun ans Tageslicht in der Gestalt seines unmittelbaren Gegenteils, in der Gebrauchswertgestalt derselben Ware, die hier als Wertding zu dienen hat. Sie gibt daher den gesellschaftlichen Ursprung ihrer Werteigenschaft nicht preis, scheint diese vielmehr in ihrer Natur als Gebrauchswert zu besitzen.
Es ist diese bestimmte Seite der Wertform, die Eigentümlichkeit der Äquivalentform, in der das „Geheimnis aller Wertform“, das „Geldrätsel“ steckt. Und es wird nun wohl auch klar, warum gleich bei der Einführung in die Wertform Marx darauf besteht, dass die zweite, als Äquivalent dienende Ware „eine passive Rolle“ spiele. Sie scheint aus eigener Herrlichkeit die Wertgestalt der ersten Ware zu spielen: als die naturreine, waschechte Verkörperung schlechthin des Werts, denn sie spielt genau besehen überhaupt keine „Rolle“, sondern bloß sich selbst, wie sie leibt und lebt. Genau darin aber mangelt es ihrer Wertdarstellung an der ersten wesentlichen Bestimmung des Werts: nämlich vom Gebrauchswert, der den Warenkörper bewohnt und gestaltet, verschieden zu sein. Und so kommt heraus, dass ihre Wertdarstellung der ganz ohne ihr Zutun entstehende Reflex jener ersten Ware ist, die ihr Wertsein ausdrückt in der Verschiedenheit des Gebrauchswerts einer anderen Ware von ihrem eigenen. Die als Äquivalent fungierende Ware gibt tatsächlich nur einen Spiegel ab, in dem die erste Ware sich selbst als Wertding anblickt, aus dem sie sich das Bild ihres eigenes Wertseins zurückwerfen lässt.
Vorläufiges Resümee: Drei Hauptaspekte der Wertformanalyse
Dieses Geheimnis der Wertform lüftet indes nur,
wer erstens im Auge behält, was in ihr erscheint, als was der Wert seinem Inhalt nach bestimmt war; dass also die Waren ihre Qualität als wertbesitzende Dinge nur entliehen haben aus der gesellschaftlichen Beziehung ihrer Produzenten aufeinander; hierin liegt begründet, warum Wertkritikern, d.h. Leuten, die den Wert, sofern sie sich darunter „überhaupt etwas … zu denken“[14] erlauben, schlechthin für eine böse oder geniale Schöpfung „des Kapitalismus“ oder „der Warengesellschaft“ aus eigener Herrlichkeit halten, das Geheimnis der diesen Inhalt spezifisch ausdrückenden Wertform ewig eines bleiben muss;
wer zweitens konkret ins Auge fasst, wie jener bestimmte Inhalt erscheint, d.h. an der Wertform, der Erscheinungsform des Werts, ihre verschiedenen Merkmale festhält sowie gleichermaßen deren einerseits gegenseitige Bedingtheit, andererseits je besondere Form, die Unterschiede in der Form selbst gegeneinander, und erst darüber schließlich das Ganze ihres Zusammenhangs erfasst;
wer drittens die Formbestimmungen des Werts als deren Entwicklung begreift und so die Schwierigkeit bewältigt, an der alle bürgerliche Ökonomie scheitert, die wohl versteht, dass das Geld zurückgeht auf die einfache Ware, ebenso wohl aber zugeben muss, dass die Waren für ihre regelmäßige Betätigung als solche, ihren Austausch, immer schon das von ihnen unterschiedene Geld als ihr Gegenüber benötigen, und die aus diesem Widerspruch bis ans Ende ihrer Tage keinen Ausweg finden wird, weil solche Wissenschaft sich nun einmal darüber definiert, ihren Gegenstand als Komplex natürlicher Gegebenheiten, absoluter Größen, statt historisch spezifischer ökonomischer Formen aufzufassen.
Der Stellenwert dieses dritten Gesichtspunktes der Wertformanalyse sei hier abschließend noch etwas erläutert.
Entwicklung der Wertform
Der bestimmte Zusammenhang von einfacher, entfalteter und allgemeiner Wertform besteht gerade darin, dass in dieser Stufenfolge der Wertausdruck den Gegensatz seiner beiden Momente herausbildet. In der einfachen oder zufälligen Wertform, also dem Wertausdruck einer beliebigen Ware in einer beliebigen anderen, erscheint dieser Gegensatz selber noch zufällig und willkürlich, ist schwer überhaupt zu erkennen und noch schwerer festzuhalten, weil diese Form unmittelbar ihre eigene Umkehrung in sich einschließt. Ob ich sage: „Ware A drückt ihren Wert in Ware B aus“ oder: „Ware B den ihren in Ware A“, das macht keinen Unterschied, weder an der Form dieser Aussage, noch auch nur an ihrem Inhalt, denn „A“ und „B“ stehen halt jedesmal beide für eine beliebige Ware, also auch für die jeweils andere. In dieser Beliebigkeit des Wertausdrucks ist aber zugleich der Fortgang zu seiner entfalteten Form enthalten. Sagen wir nämlich, für den Wertausdruck einer Ware A komme jede beliebige andere Ware gleichermaßen in Frage, dann haben wir sie an sich schon in Beziehung gesetzt zu jeder dieser anderen Waren. Die Ausformulierung dieser totalen, oder entfalteten Wertbeziehung einer Ware auf die übrige Warenwelt zeigt nun einen in Form und Inhalt veränderten Wertausdruck.
Der Wert dieser Ware ist ausgedrückt als ihre qualitative Gleichheit nicht mehr nur mit einer sondern mit allen anderen Waren, daher mit keiner bestimmten, worin er sich spiegelt, im Besonderen. Auf der anderen Seite spielt jede dieser anderen zum Wertausdruck dienenden Waren jetzt nur noch die Rolle eines besonderen Äquivalents unter vielen, die sich alle gegenseitig ausschließen: Der ihren Wert ausdrückenden Ware in relativer Wertform steht eine unendliche Reihe verschiedener, miteinander konkurrierender Äquivalente gegenüber. Und noch in einer weiteren Hinsicht erscheint die Einfachheit der ersten, zufälligen Wertform als aufgehoben. Die Ware, die ihren Wert ausdrückt, findet in gewisser Weise hier die rationellste, ihren gesellschaftlichen Inhalt am wenigsten mystifizierende Form dieses Ausdrucks. Sie begreift die Gesamtheit der Warenwelt darin ein, aber so, dass jede ihrer Mitbewohnerinnen derselben Welt, sobald sie es ihr nachtut, sich einen davon verschiedenen, besonderen eigenen totalen Ausdruck ihres Werts, also ihrer Gleichheit mit allen anderen, suchen muss.
Schließlich enthält die entfaltete Wertform einer Ware, weil sie wesentlich nur eine unendliche Summe einfacher Wertausdrücke darstellt, gleichfalls, wie diese ihre Elemente selbst, ihre eigene Umkehrung. Während jedoch eine solche Umkehrung des einfachen Wertausdrucks diesen, wie oben gezeigt, in Form und Inhalt vollkommen unverändert lässt, ergibt jetzt die bloße Umkehrung des Ausdrucks (d.h. die Summe der umgekehrten Ausdrücke) eine gänzlich veränderte Form, nämlich die allgemeine Wertform. In dieser erhalten alle Waren wieder einen einfachen, zugleich aber gemeinsamen relativen Wertausdruck und sind so erst als jede mit jeder anderen Gleichartige, daher erst wirklich als Werte aufeinander bezogen. In der dieser allgemeinen Wertform entsprechenden Form des Äquivalents andererseits erscheint die darin befindliche Ware als einheitliche Wertgestalt aller anderen Waren gerade dadurch, dass diese von der allgemeinen Äquivalentform ausgeschlossen sind, wie umgekehrt die allgemeine Äquivalentware vom allgemeinen Ausdruck ihres relativen Werts ausgeschlossen ist, sie daher ihren relativen Wert nur in besonderer entfalteter Form, also in jener unendlichen Reihe besonderer Äquivalente ausdrücken kann. Die zwei Momente des Wertausdrucks, relative Wertform und Äquivalentform sind hier als gegensätzliche Pole fixiert.
Bestand die Schwierigkeit bei der unentwickelten, einfachen Wertform darin, die Formunterschiede an ihr festzuhalten, so liegt die Schwierigkeit bei der fertig entwickelten, allgemeinen Wertform darin, den Formzusammenhang derselben nun fixierten Pole des Wertausdrucks wiederzufinden. Namentlich mit der Geldform, die nur die mit einer bestimmten Ware verwachsene allgemeine Äquivalentform darstellt, erscheint das allgemeine Äquivalent, die unmittelbare Austauschbarkeit einer bestimmten Ware mit allen anderen, als die Betätigung einer vollkommen selbständigen Eigenschaft des diese Rolle spielenden bestimmten Gebrauchswerts. Die Tatsache, dass die Geldware diese Rolle nur spielt, weil und sofern alle anderen Waren sie zum gemeinsamen Ausdruck ihres Werts erwählt haben, erscheint in der Geldform gerade anders herum: Alle übrigen Waren scheinen nur Wert zu besitzen, weil und sofern das Geld, der leibhaftig gewordene Wert, sich mit ihnen austauscht.[15]
Kurzes Fazit
Die Wertkritik glaubt mit der im Wert festgehaltenen Gleichheit der Arbeitsprodukte unmittelbar dem entscheidenden Widerspruch oder auch Widersinn der kapitalistischen Gesellschaft auf der Spur zu sein und verfehlt in solch irriger Annahme ihren Gegenstand gleich doppelt.
Der Wert, wie er in der Analyse der Ware bestimmt und dargestellt wird, ist der Wert der Ware, der in der einfachen Zirkulation der Waren betätigt wird, noch nicht der Wert, der sich selbst verwertet und dadurch Kapital wird. Damit der Wert im Wechsel seiner beiden Grundformen Ware und Geld beständig als sich selbst erhaltendes und erneuerndes Subjekt gleichsam automatisch prozessieren kann, sind nicht mehr nur Waren vorausgesetzt, wie sie deren Formanalyse unterstellen muss: beliebige Waren, Waren jeder möglichen konkreten Beschaffenheit, und also auch beliebige Warenbesitzer, sondern die bestimmte Ware Arbeitskraft, also zwei Klassen bestimmter, gegensätzlich bestimmter Warenbesitzer:[16] Monopolisten aller gegenständlichen Bedingungen der Arbeit (Produktions- und Lebensmittel der Arbeit), die damit zu Kapital werden, einerseits, sowie andererseits Arbeiter, die als leibhaftige Quelle der gar nicht mehr so ominösen „abstrakten Arbeit“, durch ihren Ausschluss vom Besitz an jenen Bedingungen auf ihre bloß subjektive Fähigkeit zur Arbeit reduziert sind und daher diese, ihre Arbeitskraft, an jene Monopolisten verkaufen müssen, damit sie sich betätigen kann. Der entscheidende Widerspruch einer solchen Gesellschaft ist immer noch der Gegensatz dieser zwei Klassen: Kapitalisten und Proletarier, von dem aber in der analytischen Darstellung der Ware und ihrer Metamorphosen abstrahiert werden muss, so wie etwa in der Biologie bei der Darstellung des Grundaufbaus einer Zelle von allen Besonderheiten bestimmter Zellen und ihren je besonderen Beziehungen aufeinander abzusehen ist.
Die Analyse des Tauschwerts bewegt sich also, wie es ihr Gegenstand verlangt, im Umkreis der Kategorien einfacher Waren und ihrer Beziehungen aufeinander. Deren Analyse hat die strickte Unterscheidung zwischen Gebrauchswert und Wert der Ware zum alles bestimmenden Ausgangspunkt. Wertkritik neigt dazu, diesen Unterschied zu einem die ganze Gesellschaftsformation charakterisierenden Widerspruch aufzublasen und erweckt so den Eindruck, als hätten wir es darin mit der Tyrannei einer illegitimen Abstraktion Namens „Wert“ über den seinerseits ganz unschuldigen Gebrauchswert zu tun. Entsprechend hätte dann die Umwälzung dieser Gesellschaft jene Tyrannei zu stürzen und den Gebrauchswert gewissermaßen wieder in sein Recht zu setzen. Wie das Resultat einer solchen „Revolution“ praktisch aussähe, kann in jeder kapitalistischen Schwitzbude konkret besichtigt werden, wo die Arbeitskräfte einem gnadenlosen Diktat des Gebrauchswerts noch in seiner borniertesten Form unterworfen sind.
Aber in dieser Betrachtung ist der Gebrauchswert noch erst nur als beliebiger, daher ganz inhaltlos vom Wert unterschieden; eine Unterscheidung, deren Pole im Jenseits der Sphäre des Warenverkehrs regelmäßig beziehungslos wieder auseinanderfallen. Zu einem diesen bloß formellen Unterschied übersteigenden, eine ganze Gesellschaft erfassenden Widerspruch, worin dann Wert und Gebrauchswert, wechselseitig sich durchdringend, aufeinander angewiesen bleiben; worin der Wert im Gebrauchswert der eingetauschten Ware nicht zugrundegeht, sondern sich erhält, gelangen wir, wie gesagt, erst, wenn wir die unabdingbare Voraussetzung der Analyse von Ware und Geld, die Beliebigkeit der ausgetauschten Waren, daher des im Austausch gegen die selbständige Wertgestalt, das Geld, erlangten Gebrauchswerts, fallen lassen.[17] Über diese gravierende Zäsur, die das in Kapital verwandelte Geld scheidet von diesem als dem Inbegriff der einfachen, für sich betrachteten Warenzirkulation, setzt der Wertkritiker sich stillschweigend hinweg, ja er nimmt sie wohl nicht einmal wahr.
Auf der anderen Seite verschwimmt in solchem unvermittelt urteilenden Blick der Wertkritik auf das Ganze besagter Gesellschaft der wirkliche Gegenstand der Waren- und Wertformanalyse zu einem unbestimmten, konturlosen Etwas. Das Ganze der kapitalistischen Gesellschaft vermeintlich schon präzise im Visier, scheint die analytische Darstellung der Wertform nur noch dazu zu taugen, das bereits feststehende Urteil beispielgebend zu bestätigen – weshalb man meist sich mit Marxens resümierendem Fazit seiner Formanalyse des Werts allein begnügt, das ab der zweiten Auflage seines Kapitals unter einer gesonderten Überschrift den seither zwar ziemlich berühmten, aber kaum verstandenen „Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis“ noch einmal herausstreicht, ohne die vorausgegangene Analyse, die ihn im Detail bereits dargestellt und begründet hat,[18] näher zur Kenntnis genommen zu haben. Oder vielleicht auch umgekehrt: Weil sie im Ernst nicht die Geduld und Sorgfalt aufbringen kann oder mag, die verlangt ist, um durch die Untersuchung der „Elementarform“ kapitalistisch produzierten Reichtums sich einen Zugang ins innerste Getriebe seiner Produktion zu graben, belässt es die Wertkritik bei äußerlichen Urteilen des ersten, rasch alles überfliegenden Blicks.
[1] Materialsammlung 7.3 des Offenen Kommunistischen Forums (OKF) Hamburg vom 19.3.1997 zum Thema: „Das Kapital - von Marx. Erster Abschnitt: Ware und Geld“, S. 20.
[3] Vgl. Materialsammlung a. a. O., S. 23. Leider wird der Erkenntnisgewinn solcher Einwände regelmäßig dadurch verdorben, dass sie an ihrem Ende auf dem denkbar kürzesten Wege auf allzu naheliegende positive Schlussfolgerungen verfallen. So auch hier. Der Verweis auf die Evidenz, mit der die Form des Akkordlohns zeigt, wie sehr es in der kapitalistischen Fabrik auf die konkrete Arbeit ankommt, geht schließlich doch gründlich in die Irre, weil er zugleich das, was dieselbe Form über den Lohn erzählt, für bare Münze nimmt: Er pocht darauf, dass „nicht die abstrakte Arbeitszeit ... bezahlt“ werde, sondern die konkrete Arbeitsleistung. In Wahrheit indes: weder noch. Weder die abstrakte, noch die konkrete Arbeit (resp. Arbeitszeit oder -leistung) wird bezahlt, sondern die Arbeitskraft, und deren Wert hat mit der (konkret oder abstrakt) geleisteten Arbeit nichts zu tun, was erst unbezahlt vom Kapitalisten angeeignete Mehrarbeit, d.h. überhaupt das Kapitalverhältnis möglich macht, ohne dass das Wertgesetzt dabei verletzt würde. Die besondere Form des Lohns sorgt nur besonders effektiv dafür, dass der Arbeiter sich trotzdem konkret ins Zeug legt und ihm – sofern er sich, wie in diesem Fall, von ihr blenden lässt, statt sie kritisch zu zerlegen – das Geheimnis, das Wie seiner Ausbeutung, so deutlich er diese auch zu spüren bekommen und erahnen mag, verborgen bleibt.
[4] MEW 23, S. 87.
[5] Der tautologische Unsinn des fraglichen Satzes gibt an sich bereits dadurch sich zu erkennen, daß „aller Reichtum“ darin „gleichgesetzt“ wird, bevor irgendeine Verschiedenheit an ihm auszumachen wäre, denn als „Reichtum“ ist das so Bezeichnete, worin es auch im Einzelnen bestehe, natürlich immer schon ein und dasselbe, mit sich selbst identisch und gibt es daher an ihm nichts noch eigens gleich zu „setzen“.
[6] „Das Gemeinsame, was sich im Austauschverhältnis oder Tauschwert der Ware darstellt, ist also ihr Wert.“ (MEW 23, S. 53). „Wenn es im Eingang dieses Kapitels in der gang und gäben Manier hieß: Die Ware ist Gebrauchswert und Tauschwert, so war dies, genau gesprochen, falsch. Die Ware ist Gebrauchswert oder Gebrauchsgegenstand und ‚Wert‘. Sie stellt sich dar als dies Doppelte, was sie ist, sobald ihr Wert eine eigne, von ihrer Naturalform verschiedene Erscheinungsform besitzt, die des Tauschwerts, und sie besitzt diese Form niemals isoliert betrachtet, sondern stets nur im Wert- oder Austauschverhältnis zu einer zweiten, verschiedenartigen Ware. Weiß man das jedoch einmal, so tut jene Sprechweise keinen Harm, sondern dient zur Abkürzung.“ (Ebd. S. 75)
[7] Unser Wertkritiker geht dagegen, ähnlich wie der derzeitige Guru der Wertkritik, Robert Kurz, nicht von der Ware aus, sondern lässt aus dem Wert die Ware „werden“: „Der Wert bestimmt den Charakter der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit … Der gesellschaftliche Stoffwechsel kann sich also nur darüber vermitteln, daß die Arbeitsprodukte zueinander in Beziehung treten: sie werden zu Waren.“ (Materialsammlung a. a. O., S. 20)
[8] Über diese durchaus progressive geschichtliche Rolle der Warenproduktion siehe auch Daniel Dockerill: Wertkritischer Exorzismus statt Wertformkritik. Zu Robert Kurz’ „Abstrakte Arbeit und Sozialismus“, Norderstedt 2014, S. 50 ff. sowie 86 f. (ursprünglich erschienen in übergänge Nr. 2, 1995, s. dort S. 64 f. sowie 80; eine online-Version des Textes gibt es außerdem bei trend.infopartisan.net).
[9] Die Behauptung eines Bruchs zwischen der Bestimmung der Wertsubstanz einerseits und der Entwicklung der Wertform andererseits in Marxens Darstellung musste seinerzeit (1965) dem Stammvater aller neulinken Wertkritik, Hans Georg Backhaus, seine sogenannte „monetäre Werttheorie“ begründen helfen: „Im ersten Abschnitt geht Marx bekanntlich in der Weise vor, dass er von dem ›empirischen‹ Faktum Tauschwert ausgeht und diesen als ,Erscheinungsform eines von ihm unterscheidbaren Gehaltes‘ bestimmt. Dasjenige, was dem Tauschwert ›zugrunde‹ liegen soll, wird Wert genannt. Im Fortgang der Analyse ist dieser zunächst jedoch unabhängig von seiner Form zu betrachten. Die von der Erscheinungsform unabhängige Analyse des Wesens führt nun dazu, dass Marx gänzlich unvermittelt, ohne Aufweis einer inneren Notwendigkeit, zur Analyse der Erscheinungsform zurückkehrt …“ (Hans Georg Backhaus: Zur Dialektik der Wertform. In: Alfred Schmidt (Hg.): Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie. Frankfurt a.M. 1969, S. 130. Vgl. dazu Daniel Dockerill: Wertkritischer Exorzismus, a. a. O., S. 57 ff. bzw. S. 67 ff.)
[10] MEW 23, S. 62.
[11] Ebd.
[12] Adam Smith in seinem Werk „Reichtum der Nationen“ (Paderborn [Voltmedia] o. J.) z. B. macht zunächst (erstes Buch, viertes Kapitel, S. 26 ff.) „mancherlei verschiedene Waren … als passend“ für den Beruf des Geldes aus, und sieht sodann „die Menschen schließlich bestimmt“, „den Metallen vor allen anderen Waren den Vorzug zu geben“, als universeller Gegenstand des Austausch zu dienen, um später (zweites Buch, zweites Kapitel, S. 293 f.) das Geld zum „große[n] Umlaufrad“ zu küren, das „durch seine Vermittlung“ die Güter „umlaufen“ lässt.
[13] Marx spricht vom „gesellschaftlichen Verhältnis“ und nicht einfach vom „Verhältnis“. Genau genommen ist der Ausdruck „gesellschaftliches Verhältnis von Ware zu Ware“ tautologisch, denn in ihrer spezifischen Bestimmung als Waren, also als nicht bloße Gebrauchswerte, sind Verhältnisse unter den Waren immer gesellschaftliche. Da aber Waren immer auch Gebrauchswerte sind und hier zudem ihr Dasein als solche auch eine ökonomisch formbestimmende Rolle spielt, drückt die Formel „gesellschaftliches Verhältnis von Ware zu Ware“ mehr als nur eine Tautologie aus: Sie stellt klar, dass die Waren sich hier als Waren, als werttragende Gebrauchsdinge oder richtiger noch: als Wertdinge, die auch Gebrauchswert haben, zueinander verhalten. Bloße Gebrauchswerte treten auch in ein Verhältnis zueinander, wenn sie ihren je spezifischen Nutzen miteinander kombinieren, aber eben in kein gesellschaftliches.
[14] Marx: Theorien über den Mehrwert. MEW 26.3, S. 143.
[15] Ein phänomenaler Umstand, der in der sogenannten „monetären Werttheorie“ wertkritisch dahin systematisiert wird, dass, weil der Austauschprozess der Waren Geld voraussetzt und daher die Gleichheit der Waren als Werte erst mit dem Dasein des Geldes sich betätigen kann, sie auch erst mit dem Geld sich im Austauschprozess herstelle, dass gewissermaßen nur, wo „Wert“ draufstehe, gleiche menschliche Arbeit drinstecke. Michael Heinrich, ein jüngerer gelehrter Vertreter dieser famosen Theorie, hat aus ihr den an sich auf der Hand liegenden Schluss dankenswerterweise dann auch gezogen, dass „vermittelnde Instanzen“, als welche im Kapitalismus das Geld figuriere, der Menschheit am besten auf ewig, jedenfalls auch im Sozialismus erhalten bleiben sollten, alldieweil sie sonst in irgendwelche barbarischen Vorzeiten, in denen die Menschen sich höchstens ausnahmsweise als solche begegneten, zurückzufallen verdammt wäre. Vgl. Daniel Dockerill: Skizzen einer Kritik an Michael Heinrich und anderen.
[16] Warenbesitzer, denen je eine andere Seite dieser spezifischen Ware am Ende zufällt, der (ordinäre, sehr beschränkte) Wert ihrem Verkäufer, der (sehr spezifische, der Überschreitung dieser Beschränktheit fähige) Gebrauchswert ihrem Käufer.
[17] „Um aus dem Verbrauch einer Ware Wert herauszuziehn, müßte unser Geldbesitzer so glücklich sein, innerhalb der Zirkulationssphäre, auf dem Markt, eine Ware zu entdecken, deren Gebrauchswert selbst die eigentümliche Beschaffenheit besäße, Quelle von Wert zu sein, deren wirklicher Verbrauch also selbst Vergegenständlichung von Arbeit wäre, daher Wertschöpfung.“ (MEW 23, S. 181)
[18] Vom „der Waarenwelt anklebenden Fetischismus“ ist zwar bereits in der Erstauflage (erstmals dort S. 42; vgl. auch MEW 23, S. 97) die Rede, wenn auch nicht in jener späteren herausgehobenen Form. Dafür stößt einen aber der dieser Erstausgabe beigefügte Anhang über die Wertform (S. 764 ff.), der die spätere Fassung des entsprechenden Unterabschnitts im Kapitel über die Ware in gewisser Weise vorwegnimmt, zweimal sogar mit der Nase drauf, wie jener Fetischcharakter der Ware insbesondere an der Äquivalentform haftet, wenn es dort (S. 774) heißt, er sei „frappanter in der Aequivalentform als in der relativen Werthform“ bzw. trete „schlagender an der Aequivalentform als an der relativen Werthform hervor.“
[Red. Anm. v. Juni 2025: Diese 2004 überarbeitete Fassung wird hier nachträglich dokumentiert. Im Archiv gibt es zum Download außerdem sowohl den ursprünglichen Text von 1997 als auch die Materialsammlung 7.3, aus der hier zitiert wird, sowie einige andere Materialien des OKF Hamburg.]



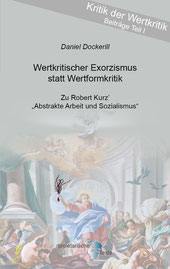


Kommentar schreiben