Gegen einen Missbrauch der Schrift Rosa Luxemburgs
über „Die Krise der Sozialdemokratie“
Von Daniel Dockerill
„Gegen die Orientierungslosigkeit der gesellschaftlichen Linken angesichts westlicher Kriegspropaganda hilft nur eine klare Analyse der objektiven Verhältnisse – und ein Blick in die Geschichte“, schreibt in der jungen Welt vom 8.4. eine Frau Voigtmann und fordert „eine Rückbesinnung auf Rosa Luxemburgs Kritik der Kriegstreiberei von links“ als dringlich ein.
Die Dame kämpft, wenn sie nicht gerade mit einer „klaren Analyse“ befasst ist, u. a. tapfer dagegen, dass in Tübingen der Name Clara Zetkins aus dem Pool der vom verlumpten Postbürgertum in Anspruch zu nehmenden, „gegen Rechts“ gebürsteten Reputierlichkeit womöglich verbannt wird. Als wäre das – objektiv betrachtet – eine Schande und geböte nicht vielmehr die Achtung vor dem Wirken und Denken Clara Zetkins, ihre Vereinnahmung durch diesen Zeitgeist zu beargwöhnen und also den Bann – so er denn Bestand haben sollte – durchaus in Ordnung zu finden oder wenigstens achselzuckend zur Kenntnis zu nehmen.
Was nun allerdings besagte „klare Analyse“ betrifft, die eine „Orientierungslosigkeit der gesellschaftlichen Linken“ beheben soll, liefert Frau Voigtmann nur heiße Luft. Hinsichtlich des derzeitigen Geschehens in Sachen Krieg schert sie viel lieber ganz unanalytisch und äußerst grob alles über einen Kamm und operiert mit ungewissen „Analogien“ zu dem, was vor gut hundert Jahren geschah. Und auch das fasst sie nur sehr grob ins Auge. Denn ihr „Blick in die Geschichte“ fahndet nach einem ihr in der Jetztzeit begegneten „Phänomen“, das sich „bis zum Ersten Weltkrieg, zurückverfolgen“ lasse, demnach seither im Wesentlichen sich gleichgeblieben wäre: dass nämlich „Krieg“, welcher auch immer, „mit Hilfe linker Rhetorik legitimiert werden kann“.
Der bestimmte, derzeit in seinem vierten Jahr tobende Krieg in der Ukraine, auf den die zur Beanstandung von ihr herangezogene „linke Rhetorik“ sich bezieht, kommt in ihrer „klaren Analyse“ nur ganz am Rande und analytisch gar nicht vor. Abgesehen davon fällt jedoch auf, dass das seltsame Kontinuum ihres hundertjährigen „Phänomens“ ein ziemlich großes Loch aufweist, über das die Autorin bei dessen Zurückverfolgung in traumwandlerischer Ignoranz hinweg gehupft ist: Während sie „eines weiteren potentiellen Weltkriegs“ bereits ansichtig geworden ist, bleibt der ganz real auf den ersten Weltkrieg zwanzig Jahre später gefolgte zweite völlig unerwähnt. Er passt halt allzu schlecht in das Schema ihres „Phänomens“, hat er doch dessen Merkmale allesamt gründlich dementiert. Denn erstens „kapitulierte“ in diesem Fall der Sozialismus nicht erst vor irgendeiner ihn einleitenden „Kriegstreiberei“, sondern bereits sechs Jahre vorher vor seiner eigenen Zertrümmerung durch den Nationalsozialismus. Zum Zweiten wurde an seinem Beginn keineswegs „die ideologische Legitimierung des Kriegs“ seitens des Sozialismus zum Problem, sondern – was den offiziellen Kommunismus betrifft, aus dessen argumentativem Arsenal die Autorin sich hier zweifellos bedient – vielmehr eine ausdrückliche Delegitimierung des Krieges gegen den nazistischen Aggressor, mit dem die Sowjetunion einen Nichtangriffspakt geschlossen hatte. Und schließlich hat zum Dritten auch nicht irgendeine „ideologische Legitimierung“, sondern Hitlers Bruch des Pakts dann doch alle Zweifel an der Berechtigung des Krieges gegen Hitler-Deutschland und seine Verbündete beseitigt und einem sozialistischen Patriotismus – ob in Gestalt des Stalinschen „Großen vaterländischen Kriegs“ oder auch beispielsweise der französischen Resistance – das Feld bereitet.
Hätte Frau Voigtmann die Schrift Rosa Luxemburgs über „Die Krise der Sozialdemokratie“ aufmerksam bis zu Ende gelesen und sich in sie und ihren historischen Kontext hineingedacht, statt sie bloß auf Stellen hin abzuklopfen, die ihr als Textbausteine für „frappierende Analogien zu aktuellen politischen Diskussionen“ dienlich schienen, dann wäre sie vielleicht über den Schluss der Schrift gestolpert, der just jene große Lücke im Kontinuum ihres „Phänomens“ betrifft, die es im Ganzen ad absurdum führt. „Der Aderlaß der Junischlächterei“ von 1848, schreibt Luxemburg dort, „hatte die französische Arbeiterbewegung für anderthalb Jahrzehnte lahmgelegt. Der Aderlaß der Kommunemetzelei hat sie nochmals um mehr als ein Jahrzehnt zurückgeworfen“, und fährt dann fort:
„Was jetzt vorgeht, ist eine nie dagewesene Massenabschlachtung, die immer mehr die erwachsene Arbeiterbevölkerung aller führenden Kulturländer auf Frauen, Greise und Krüppel reduziert, ein Aderlaß, an dem die europäische Arbeiterbewegung zu verbluten droht. Noch ein solcher Weltkrieg, und die Aussichten des Sozialismus sind unter den von der imperialistischen Barbarei aufgetürmten Trümmern begraben.“[1]
Dass 23 Jahre, nachdem sie dies niedergeschrieben hatte, bzw. zwanzig Jahre nach ihrer Ermordung genau „noch ein solcher Weltkrieg“ zur Tatsache werden würde, hat Rosa Luxemburg natürlich nicht gewusst. Aber mit dem heutigen Wissen darum unter Berufung auf ihre Schrift diese Tatsache unter den Tisch fallen zu lassen, dazu gehört schon eine beträchtliche Portion ausgebuffter Ignoranz. Es handelt sich ja nicht allein um das blanke, von heute aus gesehen durchaus begrenzte und abgeschlossene Faktum des Zweiten Weltkriegs, das da unterschlagen wird. Denn vielmehr noch erweisen sich die Worte von den unter „aufgetürmten Trümmern“ begrabenen „Aussichten des Sozialismus“ als eine weit ausgreifende fatale Prophetie. Der Sozialismus, von dem darin die Rede ist, meint nämlich nicht – da ist der Verweis auf den „Aderlaß, an dem die europäische Arbeiterbewegung zu verbluten“ drohe, davor – irgendein mit diesem Label behängtes, beliebig installierbares gesellschaftliches „System“, sondern das durch seine eigene Tat im Wege seiner Selbstabschaffung sich emanzipierende Proletariat.
Für die Kritik der Stellung ihrer Partei im ersten Weltkrieg und dessen Charakterisierung hat Rosa Luxemburg sich indes nicht mit dem Etikett des „Imperialismus“ und pejorativen Attributierungen des Kriegs begnügt. Die finden sich zwar auch in ihrer Schrift, wenn sie etwa einmal ganz allgemein den Krieg als „ein methodisches, organisiertes, riesenhaftes Morden“[2] bezeichnet, was namentlich nach der Erfahrung der Shoa, von der sie freilich nichts ahnen konnte, sich befremdlich liest. Verkennt es doch, dass auch zur Verhinderung oder Unterbindung von Mord und Totschlag glaubhafte Kriegsfähigkeit und unter Umständen wirklicher Krieg nötig sein kann, denn es ist nicht der Krieg die Quelle des Mordens im Dasein des Menschenpacks, sondern das von alters her in ihm anwesende Morden war und ist bis heute – wie zuletzt sehr drastisch der 7. Oktober 2023 gezeigt hat – die Quelle des Krieges, der es immer wieder auch zu bändigen gesucht hat.
In erster Linie jedoch geht Rosa Luxemburg in ihrer Schrift medias in res und analysiert detailliert eine Reihe unterschiedlicher Aspekte, Motive und Zwecke, welche die in den Weltkrieg involvierten Mächte verfolgen, wie auch deren je besondere Vorgeschichte. Herausragend scheint mir dabei nicht zufällig der fünfte Teil zu sein, der das Verhältnis zwischen dem zaristischen Russland und dem junkerlich-kaiserlichen Deutschland und seine Entwicklung darstellt. Dies vor dem Hintergrund, dass die in den Publikationen der SPD damals vorherrschende Rechtfertigung des kaiserlich-deutschen Krieges an der Seite der KuK-Monarchie in der Behauptung bestand, es ginge darin um die Verteidigung der auch von der Arbeiterbewegung geprägten Kultur gegen die Barbarei des Zarismus. Luxemburg dementiert das nicht einfach, sondern zeichnet im Detail nach, wie der russische Zarismus vom einstmals wirklichen „Hort der europäischen Reaktion“, der als Backup aller reaktionären Kräfte im von revolutionären Erschütterungen heimgesuchten Europa des 19. Jahrhunderts fungiert hatte, sich gewandelt hat zum selbst von seinem revolutionären Sturz bedrohten Schützling der bourgeoisen Reaktion in Europa – mit der Pointe, dass die nach ihrer Niederlage von 1905 f lange darniederliegende revolutionäre Bewegung in Russland seit etwa drei Jahren begonnen hatte, sich wieder zu beleben, als mit dem von Deutschland provozierten Kriegsausbruch ihr fürs erste einmal mehr das Licht ausgeblasen worden ist. Deutschland verhalf, schreibt Luxemburg, „dem Zarismus zu dem populärsten Krieg, den Rußland seit einem Jahrhundert hatte.“
Man weiß nicht, ob man es dreist oder bloß dämlich nennen soll, wenn Frau Voigtmann vermeint, in „aktuellen politischen Diskussionen angesichts der ‚Zeitenwende‘“ heute Punkte machen zu können mit Rosa Luxemburgs damaliger Kampfschrift gegen den Opportunismus und Verrat ihrer Genossen; wenn sie glaubt, mit als zeitlose Weisheiten dargebotenen Sätzen aus dieser Schrift Stellungnahmen zum derzeitigen Krieg in der Ukraine abtun zu können, wie beispielsweise den, „dass die Ukraine ‚in einem mörderischen Zermürbungskrieg verzweifelt um ihr Überleben kämpft‘“; oder den zweier missbilligend von ihr zitierter Autoren „von der Linkspartei“, dass es darin „um das Überleben der Ukraine als unabhängiger Staat“ gehe. Einen Versuch, solche Aussagen, die ja alles andere als aus der Luft gegriffen sind, zu widerlegen oder auch nur irgendetwas Bestimmtes dagegen in Stellung zu bringen, meidet sie wohlweislich wie der Teufel das Weihwasser, hat es lieber im vorhinein abgebucht als bloße Illustration ihres anfangs formulierten pauschalen Verdikt, die Linke verliere „mal wieder den Kopf, anstatt im Namen der internationalen Solidarität der Kriegstreiberei den Kampf anzusagen.“
„mal wieder … Kriegstreiberei“? – Das kommt offenbar davon, wenn man die eigene Geschichte, diejenige besagter „Linken“ also, nur als Steinbruch zur Aushebung ein paar griffiger Phrasen für den Hausbrauch misshandelt, anstatt sie im Detail wie als bestimmtes Ganzes gründlich zu reflektieren. Denn es gibt für Voigtmanns tapferen Vorsatz, auf keinen Fall „den Kopf zu verlieren“, sondern einer nicht näher spezifizierten „Kriegstreiberei“ entschieden entgegenzutreten, in eben dieser Geschichte ja ein – oben bereits erwähntes – ebenso bitteres wie vonseiten mancher Linker schamvoll gerne beschwiegenes Vorbild. Eines zudem, das etwas weniger lange zurückliegt als das von ihr angepriesene, jedoch kaum begriffene Vorbild der Rosa Luxemburg und ihrer Kampfschrift; eines, das aber, wie wir sahen, ganz linkstraditionell auch ihr „Blick in die Geschichte“ glücklich ausgeblendet hat. Die Komintern ernannte damals auf Stalins Geheiß hin den „englische[n] Imperialismus“, nachdem dieser Deutschland wegen Hitlers Überfalls auf Polen den Krieg erklärt hatte, zum „gefährlichen Kriegsbrandstifter und … Hauptfeind der internationalen Arbeiterklasse“[3], hüllte sich dagagen bezüglich Deutschlands Einfall in Polen in Schweigen. Daran erinnert leider fatal die Manier, wie derzeit jener Teil der Linken, für den Voigtmann hier das Sprachrohr macht, die Unterstützung der Ukraine durch Waffenlieferungen als „Kriegstreiberei“ brandmarkt und Putins Überfall, der durchaus markante Parallelen zu dem Hitlers auf Polen aufweist, fleißig herunterspielt, wenn nicht beschönigt oder sogar gutheißt. Parallelen übrigens, die Putin – der Bewunderer des Hitler bewundernden Stalin – sicher nicht ohne Absicht selber heraufbeschwört, wenn er jetzt gelegentlich mit dem dritten Weltkrieg droht.
[Mehr zum Thema gibt es auf planet-marx in der Rubrik Krieg & Frieden.]
[1] Rosa Luxemburg: Die Krise der Sozialdemokratie. In dies.: Gesammelte Werke Bd. 4, Berlin [Dietz] 2000, S. 163. Junius Teil VIII
[2] Ebd. S. 64. Junius Teil II
[3] Pierre Frank: Geschichte der Komintern Band 2, S. 714.



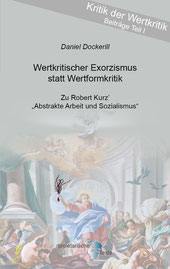


Kommentar schreiben