Hannah Arendts in ihrem Buch „Über die Revolution“
Von Daniel Dockerill
Im Zentrum ihres Buches „Über die Revolution“, im englischen Original 1963 erschienen, erörtert Hannah Arendt – teils in epischer Breite – die Unterschiede der amerikanischen Revolution gegenüber der großen französischen sowie den von dieser eingeleiteten weiteren kontinental-europäischen Revolutionen vor allem des 19. Jahrhunderts. Gegen Ende des Buches gibt es indes ein in gewisser Weise darüber hinausweisendes Kapitel mit Überlegungen „über die seltsame und traurige Geschichte des Rätesystems“. Darin finden nicht zuletzt einige einschlägige „Bemerkungen von Marx und Lenin“, nach Arendts Urteil „immerhin … die beiden größten Revolutionäre des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts“ ihre Würdigung. Eine Würdigung, die indes, wie zu zeigen sein wird, schwer kontaminiert ist durch einen Vorbehalt gegen „die beiden“, der zuweilen ihren Blick auf das Gewürdigte bis zum blanken, es regelrecht entstellenden Vorurteil trübt.
Man sollte es freilich sich nicht so leicht machen, Arendts Vorbehalt als irgendein „gewöhnliches“ bürgerliche Ressentiment gegen den Kommunismus abzuheften, denn Hannah Arendt (Jahrgang 1906) ist nichts weniger als eine gewöhnliche bürgerliche Autorin. Ihre beiden Eltern, der früh verstorbene Vater wie auch die Mutter, waren Sozialdemokraten in einer Zeit als diese ihren Ruch als „vaterlandslose Gesellen“ noch nicht vollends eingebüßt hatten. Die Mutter wurde „eine glühende Verehrerin Rosa Luxemburgs“[1], die am Jahresbeginn 1919 aus der Königsberger Ferne, ihre 13-jährige Tochter an der Hand, mit auch praktischer Sympathie den Berliner Spartakus-Aufstand begleitete. Hannah Arendts zweiter und schließlich lebenslanger Mann, Heinrich Blücher, Proletarierkind in Berlin, hatte daran 20-jährig teilgenommen. 1936, als sie in Paris sich kennenlernten, gehörte Blücher zum Führungskreis der KP-Opposition um August Thalheimer und Heinrich Brandler (mit dem er wahrscheinlich befreundet war)[2] oder hatte jedenfalls engere Verbindungen dorthin. Erst bald darauf, im Zuge der Fortentwicklung der bereits angebahnten welthistorischen Katastrophe und im Erleben einer totalen Unfähigkeit des realexistenten und ja keineswegs ohnmächtigen Weltkommunismus, ihrer zu wehren, und zwar in allen seinen divergierenden Bestandteilen, löste er sich, wie nicht wenige andere, allmählich von seinen kommunistischen Überzeugungen. Zu groß und zu nachhaltig waren wohl seine wie Hannah Arendts auch an die eigene, ganz individuelle Existenz gehende, herbe Enttäuschung, Verzweiflung und sicher auch ein gerechter Zorn über die zeitgenössischen Adepten jener „größten Revolutionäre“. Hatte doch deren Scheitern schon der bloßen Selbstbehauptung, geschuldet teils kraftmeiernder Feigheit und paktiererischer Vertrauensseligkeit, zu keinem geringen Teil schließlich ins massenhaft Kriminelle abgekippter Selbstverstümmelung, am Beginn des zweiten Drittels ihres Jahrhunderts dem Grauen alle Schleusen geöffnet.
Einem mehr oder weniger noch bürgerlichen Europa, dem sein proletarischer Schatten bereits drohenden sich entgegengestellt hatte, war in seiner es bis ins Mark und zum Äußersten erschütternden Krise dieses menschenzermalmende Grauen entsprungen, statt, wie es sowohl Marx als auch Lenin dereinst erwartet hatten, in seinem Innern Kräfte der Beseitigung aller Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen durch andere Menschen freizusetzen. Und auch der schließliche Sieg über das Grauen musste hauptsächlich von außen erkämpft werden und war selbst dann nur sehr partiell geblieben. Das alles macht die Berufung auf „Marx und Lenin“ – ob vorbehaltlos oder auch kritisch-reflektiert – bis zum heutigen Tag zweifellos zutiefst fragwürdig.
Und dennoch: Die leise, aber unverkennbare Wehmut, mit der Hannah Arendt besagte „Geschichte des Rätesystems“ in ihrem Buch „Über die Revolution“ zu erzählen und „dem andenkenden Nachdenken zu empfehlen“ anhebt, verrät eine Sympathie mit den Emanzipationsanstrengungen des Proletariats und mit denen, die ihnen sowohl geistigen als auch praktisch-politischen Ausdruck verliehen haben; eine untergründige Sympathie, die deren katastrophales Versagen überdauert zu haben scheint, ohne freilich zu einer ebenso kritischen wie angemessenen Befassung damit vorgestoßen zu sein, die auch die eigenen Enttäuschungen kritisch reflektiert.
Um das Ganze der Arendtschen Würdigung weder der „Geschichte des Rätesystems“, noch dessen, was „die beiden größten Revolutionäre des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts“ dazu gedacht und geschrieben haben, soll es hier jedoch zunächst nicht gehen. Namentlich Arendts Befund zu Lenins sowohl theoretischen als auch – in einem viel handgreiflicheren Sinne als im Fall von Marx – höchst praktischen Beiträgen in Sachen jener Räte bzw. „Sowjets“ und ihrer möglichen Systematik bleibt hier außer Acht. Wie sehr indes ein wohl nicht zuletzt aus besagter Enttäuschung gespeistes, ausgesprochenes Vorurteil schon bei der Beweiserhebung das Urteil der Autorin über die Ansichten des Karl Marx jedenfalls in dieser Angelegenheit getrübt hat, sei hier zunächst nur an dem sehr speziellen Punkt erhellt, der Marxens Bewertung der Pariser Kommune von 1871 betrifft.
*
Marx habe, behauptet Hannah Arendt schon vorweg, „die Ereignisse“, die in der zweieinhalb Monate währenden, von ihr nicht zu Unrecht als „zweite“ bezeichneten „Kommune von Paris“[3] kulminierten, „nicht im mindesten vorausgesehen“[4]. Marx selbst hat das indes, ausweislich beispielsweise eines Briefes an seinen Freund Ludwig Kugelmann vom 12. April 1871, durchaus anders gesehen, wenn er darin, also inmitten des Ablaufs der „Ereignisse“, aus London schreibt:
„Wenn Du das letzte Kapitel meines ‚Achtzehnten Brumaire‘ nachsiehst, wirst Du finden, daß ich als nächsten Versuch der französischen Revolution ausspreche, nicht mehr wie bisher die bürokratisch-militärische Maschinerie aus einer Hand in die andre zu übertragen, sondern sie zu zerbrechen, …“ (MEW Bd. 33, S. 205)
Und schlägt man das (VII.) Kapitel nach, findet man in der Tat es dort als das hauptsächliche, den Interessen namentlich des Proletariats zuwiderlaufende Ungenügen aller bisherigen Revolutionen bezeichnet, dass sie die von der absoluten Monarchie zuerst entwickelte Staatsmaschinerie „vervollkommneten … statt sie zu brechen“, und dass die „Parteien, die abwechselnd um die Herrschaft rangen, … die Besitznahme dieses ungeheueren Staatsgebäudes als die Hauptbeute des Siegers“ betrachtet hatten (MEW Bd. 8, S. 197). Mit dem Staatsstreich des „dritten“ Napoleon vom 2. Dezember 1851, womit „sich der Staat völlig verselbständigt zu haben“ schien, sieht Marx diese Entwicklung als soweit vollendet an, dass nur mehr „die Revolution … alle ihre Kräfte der Zerstörung gegen sie zu konzentrieren“ (ebd. S. 196) hatte.
Diese bereits 19 Jahre vor der Errichtung der Kommune von 1871 mit einiger Hellsicht von Marx gestellte Diagnose über Perspektiven der Revolution in Frankreich macht aus ihm sicherlich keinen Hellseher, lässt aber den apodiktischen Gestus der Behauptung Hannah Arendts, Marx habe da „nicht im mindesten“ etwas „vorausgesehen“, in einem ziemlich seltsamen Licht erscheinen. Besagte „Ereignisse“, so stellt sie es dar, hätten an sich „im Widerspruch“ zu Marxens Auffassungen von der Revolution und all seinen „Überzeugungen über das Wesen von Macht und Gewalt“ gestanden. Eine Darstellung, die freilich ihrerseits im krassen Widerspruch zu der Emphase steht, mit welcher Marx bekanntermaßen entschieden Partei ergriffen hat für „die Ereignisse“. Wie Arendt diesen Widerspruch aufzulösen versucht, soll daher nun näher betrachtet werden.
Sie schickt dazu ein grobes Schema voraus, nach welchem Revolutionen sozusagen üblicherweise abzulaufen pflegen, das sich dadurch auszeichnet, dass darin die wirklichen Mächte und die wirkliche Gewalt und ihre enorme Rolle im Verlaufe der infrage stehenden „Ereignisse“ rund um die 1871er Kommune ausgeblendet bleiben. Zu „der erstaunlichen Bildung einer neuen Machtstruktur“ kommt es in Arendts Revolutionen generell wie von Geisterhand und ebenso geisterhaft hat zur selben Zeit die alte „zu existieren aufgehört“. Das muss im Einzelnen aber an anderer Stelle erörtert werden.
Sodann referiert und kommentiert Arendt, was Marx im „Bürgerkrieg …“ zu jenen „neuen Machtstrukturen“ geschrieben hat, die angeblich seinen „Überzeugungen über das Wesen von Macht und Gewalt“ widersprechen, folgendermaßen:
„Nun ist es immerhin bemerkenswert, daß Marx für eine kurze Zeit angesichts der ihn gänzlich überraschenden Vorgänge in Paris von einer ‚die Einheit der Nation [...] [organisierenden] Kommunalverfassung‘ sprach und ausdrücklich darauf hinwies, man habe es hier nur mit ‚einer kurzen Skizze der nationalen Organisation [zu tun], die die Kommune nicht die Zeit hatte, weiter auszuarbeiten‘, daß aber deutlich sei, daß ‚die Kommune die politische Form selbst des kleinsten Dorfes sein [...] sollte‘. Er schloß aus alledem, eine solche, auf das ganze Land sich erstreckende Kommunalverfassung ‚sei die endlich entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte‘, ja dies sei ‚ihr wahres Geheimnis‘. In dieser Zeit war ihm auch klar, daß ‚diese neue Kommune, die die moderne Staatsmacht bricht‘, prinzipiell ‚das Nichtbestehen der Monarchie‘ voraussetzt und der Republik ‚die Grundlage wirklich demokratischer Einrichtungen‘ verschafft.“
Mit dieser Marxschen Bewertung der Pariser Kommune ist Arendt völlig einverstanden, schließt aber unmittelbar daran die folgende Behauptung an:
„Aber zwei Jahre später hatte er diese Träume eines lokalen Selbstregierungssystems, die den wirklichen Verhältnissen entsprachen, bereits aufgegeben und war zu der ‚realpolitischen‘ Vorstellung von der Diktatur des Proletariats zurückgekehrt. Nun meinte er: ‚Die Arbeiter müssen [...] auf die entschiedenste Zentralisation der Gewalt in die Hände der Staatsmacht hinwirken. Sie dürfen sich durch das demokratische Gerede von der Freiheit der Gemeinden, von Selbstregierung usw. nicht irremachen lassen.‘“
Zu diesem von Marx angeblich „zwei Jahre später“ (das wäre 1873) gehaltenen Plädoyer für „die entschiedenste Zentralisation der Gewalt in die Hände der Staatsmacht“ gibt Arendt in den Anmerkungen ihres Buches [unter der Nr. 352] als Quelle die „Enthüllungen über den Kommunistenprozeß zu Köln“ an, versehen mit dem Zusatz:
„zitiert nach der Ausgabe der Sozialdemokratischen Bibliothek, Bd. IV, Hattingen/Zürich 1885, S. 81.“
Jene „Enthüllungen …“ datieren jedoch in Wahrheit keineswegs von 1873, sondern aus einer Zeit fast 19 Jahre vor der Kommune, nämlich von Ende 1852 (vgl. MEW Bd. 8, S. 405 ff). Und in ihnen findet sich überdies auch nicht das von Arendt angeführte Zitat. Das ist vielmehr noch einmal zwei Jahre älter und stammt aus der von Marx und Engels gemeinsam verfassten „Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März“ (MEW Bd. 7, S. 244 ff) Es datiert also aus der Zeit noch vor der Abfassung der für die Entwicklung der Marxschen Ansichten hinsichtlich der Verfasstheit des Staates ziemlich wichtigen Schrift „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“ (MEW Bd. 8, S. 111 ff); jenes Textes, auf den Marx, wie oben bereits angeführt, in einem Brief vom 12. April 1871 (MEW Bd. 33, S. 205) an Ludwig Kugelmann verweist, worin er eine erste historische Einordnung der Pariser Ereignisse andeutet.
Just jene Stelle nun, die Arendt in „Über die Revolution“ zitiert und die aus der „Ansprache …“ vom März 1850 stammt (einer Art Bilanz der 1848er Revolution), wurde bei ihrer Wiederveröffentlichung zwei Jahre nach Marxens Tod von Engels mit einer bemerkenswerten Fußnote versehen, die hier im Wortlaut wiedergegeben sei:
„Es ist heute zu erinnern, daß diese Stelle auf einem Mißverständnis beruht. Damals galt es – dank den bonapartistischen und liberalen Geschichtsfälschern – als ausgemacht, daß die französische zentralisierte Verwaltungsmaschine durch die große Revolution eingeführt und namentlich vom Konvent als unumgängliche und entscheidende Waffe bei Besiegung der royalistischen und föderalistischen Reaktion und des auswärtigen Feindes gehandhabt worden sei. Es ist jetzt aber eine bekannte Tatsache, daß während der ganzen Revolution bis zum 18. Brumaire die gesamte Verwaltung der Departements, Arrondissements und Gemeinden aus von den Verwalteten selbst gewählten Behörden bestand, die innerhalb der allgemeinen Staatsgesetze sich mit vollkommener Freiheit bewegten; daß diese der amerikanischen ähnliche, provinzielle und lokale Selbstregierung grade der allerstärkste Hebel der Revolution wurde, und zwar in dem Maß, daß Napoleon unmittelbar nach seinem Staatsstreich vom 18. Brumaire sich beeilte, sie durch die noch bestehende Präfektenwirtschaft zu ersetzen, die also ein reines Reaktionswerkzeug von Anfang an war. Ebensowenig aber, wie lokale und provinziale Selbstregierung der politischen, nationalen Zentralisation widerspricht, ebensowenig ist sie notwendig verknüpft mit jener bornierten kantonalen oder kommunalen Selbstsucht, die uns in der Schweiz so widerlich entgegentritt und die 1849 alle süddeutschen Föderativrepublikaner in Deutschland zur Regel machen wollten.“ (MEW Bd. 7, S. 252 f)
Übrigens scheint die Wiederveröffentlichung der „Ansprache …“ (dies ist einem ihr vorangestellten redaktionellem Hinweis in den MEW zu entnehmen) im Rahmen einer „Neuausgabe der Schrift ‚Enthüllungen über den Kommunisten-Prozeß zu Köln‘“ geschehen zu sein, und daraus erklärt sich wohl, warum Arendt das Zitat diesem Text, statt der „Ansprache …“ zugeordnet hat, denn aus einer Ausgabe der „Enthüllungen …“ von 1885 hat sie es ausweislich ihrer Anmerkung ja entnommen. Wie sich aber die zeitliche Einordnung („zwei Jahre“ nach der Kommune, also 1873) erklärt, bleibt dennoch unerfindlich. Das Meiste an „Erkenntnis“ in dieser Sache verdanke sie, wie sie selbst im Buch vermerkt, einer Arbeit über „Die Rätebewegung in Russland 1905–1921“ aus dem Jahr 1958 von Oskar Anweiler, aus der sie auch mehrfach zitiert.
*
Ob es wirklich stimmt, dass erst mit dem „18 Brumaire“ des Jahres VIII der französischen Revolution, d. h. des 9. Novembers 1799, dem Datum des Staatsstreichs, mit dem der originale Napoleon sich „als erster Konsul zum Alleinherrscher“ über Frankreich machte, die „der amerikanischen ähnliche, provinzielle und lokale Selbstregierung“ in Frankreich ihr Ende fand, wäre zu überprüfen. Hannah Arendt sieht das in ihrem Buch „Über die Revolution“, das die Unterschiede der amerikanischen und der klassischen französischen Revolution zum thematischen Schwerpunkt hat, durchaus etwas anders. Sie verortet einen deutlichen Gegensatz gegen jene „Selbstregierung“ bereits bei den maßgeblichen Führern der Revolution, wie Saint-Just und Robespierre und liefert dafür einige Anhaltspunkte. Diese hätten die lokale Selbstverwaltung nur solange gegen Angriffe aus der Nationalversammlung verteidigt, wie sie selbst dort noch nicht die Mehrheit hatten. Arendt kommt nicht zuletzt deshalb zu dem Schluss, dass etwa auch Lenin und Trotzki als sozusagen echte europäische (statt der amerikanischen) Revolutionäre mit einer Räterepublik nicht wirklich etwas anfangen konnten.
[1] Elisabeth Young-Bruehl: Hannah Arendt: Leben, Werk und Zeit, Frankfurt a. M. 2016 [Fischer E-Books, Verweisnr. 7.73]
[2] So jedenfalls die recht ausführliche Darstellung bei Young-Bruehl. Andernorts wird dies aber bestritten.
[3] Die erste Kommune von Paris entstand als spontanes Resultat der ersten französischen Revolution von 1789 ff. Ihre „berühmten 48 Sektionen“, schreibt Hannah Arendt, ursprünglich nur als Einteilungen für die Wahlen zur Nationalversammlung gedacht, „konstituierten sich vielmehr als reguläre Körperschaften mit Selbstverwaltung“ und „formierten den revolutionären Stadtrat, die Pariser Kommune“. Diese „Sektionen der Pariser Kommune und die Volksgesellschaften, die sich während der Revolution über ganz Frankreich verbreiteten“, so Hannah Arendt weiter, „enthielten auch die Keime, die ersten schüchternen Ansätze einer neuen politischen Organisations- und einer bis dahin unbekannten Staatsform.“ (Über die Revolution, Sechstes Kapitel, Abschnitt II.)
[4] Über die Revolution, Sechstes Kapitel, Abschnitt IV.



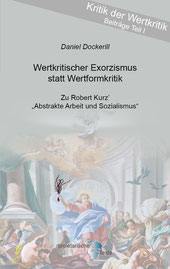


Kommentar schreiben